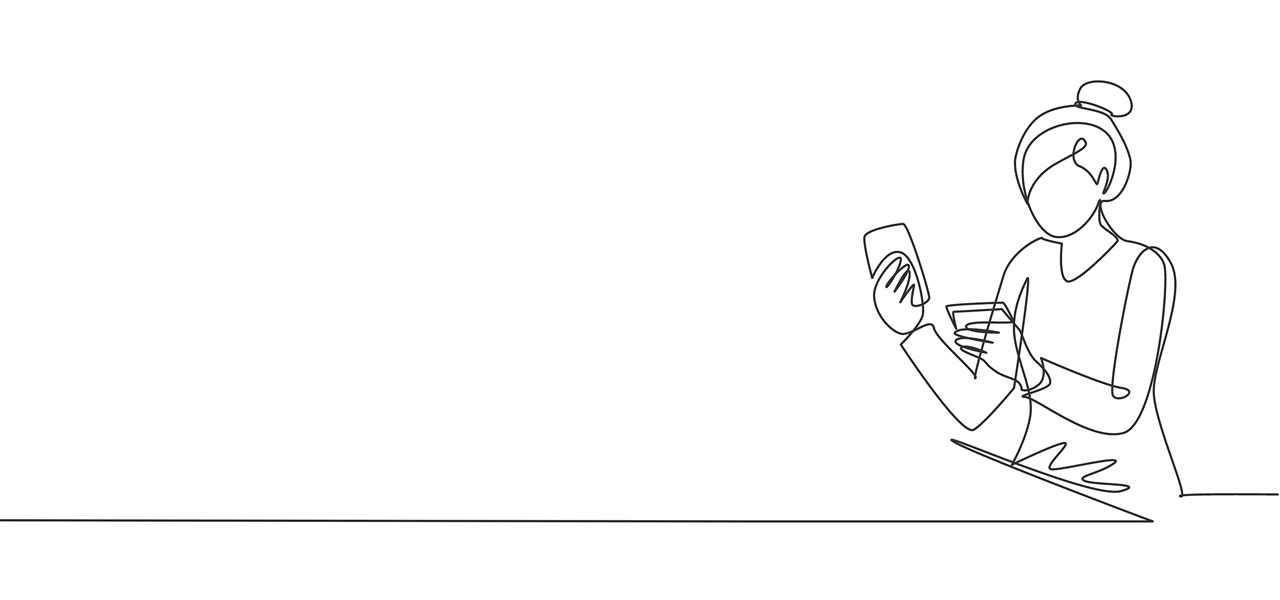
Erfolgsbewertung bei einer DiGA
Im Kabinettsentwurf des Digi-Gesetzes (DigiG) ist vorgesehen, dass 20 Prozent der von einer GKV zu erstattenden Vergütung für die Nutzung von Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) erfolgsbasiert sein müssen. Dabei sollen sich der GKV-Spitzenverband und der DiGA-Hersteller einigen, was genau den Erfolg der konkreten DiGA ausmacht.
Die Idee des Bundesministeriums für Gesundheit, eine erfolgreiche Behandlung zum Maßstab im Gesundheitsweisen zu machen, ist ein großer Meilenstein und unterstützenswert. Allerdings gibt es zwei entscheidende Fragen, die aus Patientensicht noch überarbeitungsbedürftig sind:
1. Wer soll beurteilen, ob bzw. wann eine DiGA erfolgreich ist?
Über den Erfolg oder Misserfolg einer digitalen Anwendung sollten stets die Nutzenden entscheiden. Eine Entwicklung an ihnen vorbei kann nicht nachhaltig sein. Bei DiGAs sind das aktuell ganz überwiegend Patient:innen, aber auch immer mehr Ärzt:innen.
"Über den Erfolg oder Misserfolg einer digitalen Anwendung sollten stets die Nutzenden entscheiden. "
Beschränkt man sich für diesen Artikel zunächst auf den Blickwinkel der Patient:innen, so muss zunächst klar sein, dass diese sehr verschieden sind und sich ihre Gesundheitsziele sehr stark voneinander unterscheiden können. Es sollten daher möglichst viele Patient:innen Rückmeldung geben, ob und unter welchen Begleitumständen (Komorbiditäten, Krankheitsursache(n), Medikation(en), sonstige Therapien, et cetera) sie die konkrete DiGA als hilfreich empfinden oder nicht. Dafür bedarf es einer unabhängigen und transparenten Stelle, die genau das ermöglicht. Wo diese Stelle sinnvoller Weise zu verankern ist, sollten alle Beteiligten untereinander konstruktiv klären.
§ 140f SGB V sieht vor, dass die als maßgeblich anerkannten Patient:innenorganisationen in die Entwicklungen im Rahmen der Versorgung im Gesundheitswesen einzubeziehen sind. Das ist sicher auch hier sinnvoll; denn die an die Nutzer zu richtenden konkreten Fragen zu Erfolg und Misserfolg sollten die jahrzehntelangen Erfahrungen der Patient:innenvertretungen wesentlich mit einfließen lassen und auch helfen, die Patient:innen zu motivieren, sich in diese Erfolgsbemessung einzubringen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Betroffene, die DiGA nutzen wollen und sollen, häufig durch die Erkrankung erheblich eingeschränkt sind und einen klaren Mehrwert erkennen müssen, um die zusätzliche Anstrengung der Bewertung als sinnvoll zu erachten.
Auch die Ursachen ein und derselben Erkrankung können sehr voneinander abweichen. Tinnitus – um ein Beispiel zu nennen – kann durch traumatische Ereignisse, Stress und diverse chronische Erkrankung aber auch durch unerwünschte Arzneimittelnebenwirkungen entstehen. Hinzu kommt, dass viele zu behandelnde Personen gar keine Ahnung haben, was die Ursache ihrer Tinnituserkrankung ist.
Es sollten folglich besonders informierte Patient:innen aus spezialisierten Organisationen bei den verschiedenen DiGAs eingebunden werden, um die besonderen Herausforderungen im Einzelnen zu erfassen und auch entsprechend transparent zu machen.
Jana Hassel | Referentin für Digitalpolitik, BAG SELBSTHILFE e.V. | LinkedIn | Copyright: @fotografa, Tabea Marten
2. Nach welchen Kriterien sollte der Erfolg bewertet werden?
Während Patient:innen überwiegend erwarten, dass sich ihr Gesundheitszustand verbessert, sie besser lernen, mit ihrer Erkrankung umzugehen, ihr Leidensdruck verringert wird oder ihre Erkrankung gar ganz verschwindet, wollen Ärzt:innen vor allem die Daten gut aufbereitet nutzen können, um Entwicklungen der Patient:innen zu sehen und Therapieentscheidungen zu treffen. Das sind zwei ganz verschiedene Zielrichtungen, die sehr unterschiedliche Erfolgskriterien erfordern.
Patient:innen geben immer wieder zu bedenken, dass die Nutzungsdauer oder die Zahl der Aufrufe einer DiGA eher nicht als Erfolgsfaktor gewertet werden sollten. Denn viele Menschen empfinden es gerade dann als Erfolg, wenn sie nicht auf eine digitale Unterstützung zurückgreifen müssen, ihre Beschwerden aber dennoch in den Hintergrund treten.
Aber was könnten konkrete Kriterien sein? Zur Klärung dieser Frage bedarf es eines stetigen umfassenden Austauschs zwischen Nutzenden, Herstellenden und auch den Kassen, um die Entwicklungen in diesem Bereich zielführend voranzubringen und transparent zu machen, wo Herstellung und Nutzer noch aneinander „vorbei denken“.
Es versteht sich, dass bei der Vielzahl von sehr unterschiedlichen DiGAs zwar auch generelle, für alle DiGAs geltende Kriterien greifen müssen. Allerdings muss es auch individuelle Kriterien geben, die sich unter anderem aus den durch den Herstellenden selbst formulierten Anspruch seines Produktes ableiten sollten.
Transparenz als wichtige Grundlage einer optimalen Weiterentwicklung
Eine weitere wesentliche Bedingung für die Entwicklung der DiGA an den Bedarfen und Bedürfnissen der Nutzenden entlang ist, dass die Kriterien transparent gemacht werden, um auch anderen Herstellenden zu vermitteln, worauf die DiGA-nutzenden Patient:innen besonders Wert legen und wo Defizite sind, die es gilt, mittelfristig abzubauen.
Fazit
Für eine gute Weiterentwicklung des „Export-Schlagers“ DiGA ist es wichtig, dass alle Akteur:innen – einschließlich der Patient:innen – mitbestimmen, wie optimale an den Bedarfen und Bedürfnissen ausgerichtete digitale Anwendungen aussehen. Hier stehen wir noch ganz am Anfang, aber Deutschland hat bei der DiGA-Entwicklung eine Vorreiterrolle eingenommen – diese gilt es auszubauen.



